Zu Beginn von Alba Arikhas neuem Roman Zwei Stundenist unsere 16-jährige Erzählerin Clara gerade von Paris nach Manhattan gezogen, nachdem ihr Vater eine Stelle als Dozent an der Columbia University bekommen hat. Es ist Mitte der Achtzigerjahre und sie ist überhaupt nicht glücklich über die Veränderung, obwohl die Familie in der vornehmen Park Avenue-Wohnung des viel reicheren Freundes ihres Vaters, des Kunsthändlers Andre Karlick, wohnt. Karlick hat einen 16-jährigen Sohn, Alexander, der literarisch, anspruchsvoll und sehr gutaussehend ist und in den sich Clara, vielleicht unvermeidlich, sofort verknallt. Sie nimmt dies sehr drollig auf, ist sich ihrer selbst als verliebte Teenagerin bewusst, obwohl sie zu nichts anderem fähig ist. „Ich kann meine Unwissenheit nicht zugeben“, vertraut sie dem Leser an, während Alexander seine Liebe für Dostojewski zur Schau stellt. „Ich muss einen Weg finden, das Thema zu lenken. Und was ist mit Jane Austen, wage ich zaghaft zu fragen?“
Dieser Blitzschlag der Verliebtheit wird zu einem prägenden Moment in Claras Leben, ein Beispiel dafür, wie wir so oft im Schatten dessen leben, was hätte sein können, selbst wenn dieser Schatten so oft aus unbegründeten Fantasien besteht. Alexander zieht nach London, von wo aus er Clara eine einzige Postkarte schickt (die sie wie besessen durchliest, überzeugt, dass sie eine endgültige Erklärung ewiger Liebe enthält). Und dann driften sie auseinander, bis eine weitere entscheidende Begegnung in ihren Zwanzigern im New Yorker Soho ihre Gefühle erneut in Gang setzt. Und doch heiratet sie jemand anderen, bekommt zwei Kinder und zieht selbst nach London. Viele Jahre später kommt es zu einer Art drittem Austausch; es ist ein Maß für Arikhas Geschick, dass der „Werden sie oder werden sie nicht“-Subtext dieses ansonsten ausgesprochen literarischen Romans so spannend ist wie jede Liebesgeschichte.
Arikha, deren Leben viele biografische Details mit ihrem Erzähler verbindet und deren Memoiren aus dem Jahr 2017 Dur/Mollwurde hoch gelobt, ist hierzulande aber nicht sehr bekannt. Dabei müsste sie es sein. Zwei Stunden „The 40 Fingers“ passt hervorragend in ein Subgenre von Romanen, die ausnahmslos von Frauen geschrieben werden und den Leser durch ihre autobiografische Nähe reizen, während sie gleichzeitig auf intime und selbstbewusst distanzierte Weise von den gemeinsamen weiblichen Erfahrungen von Ehe und Mutterschaft zeugen.
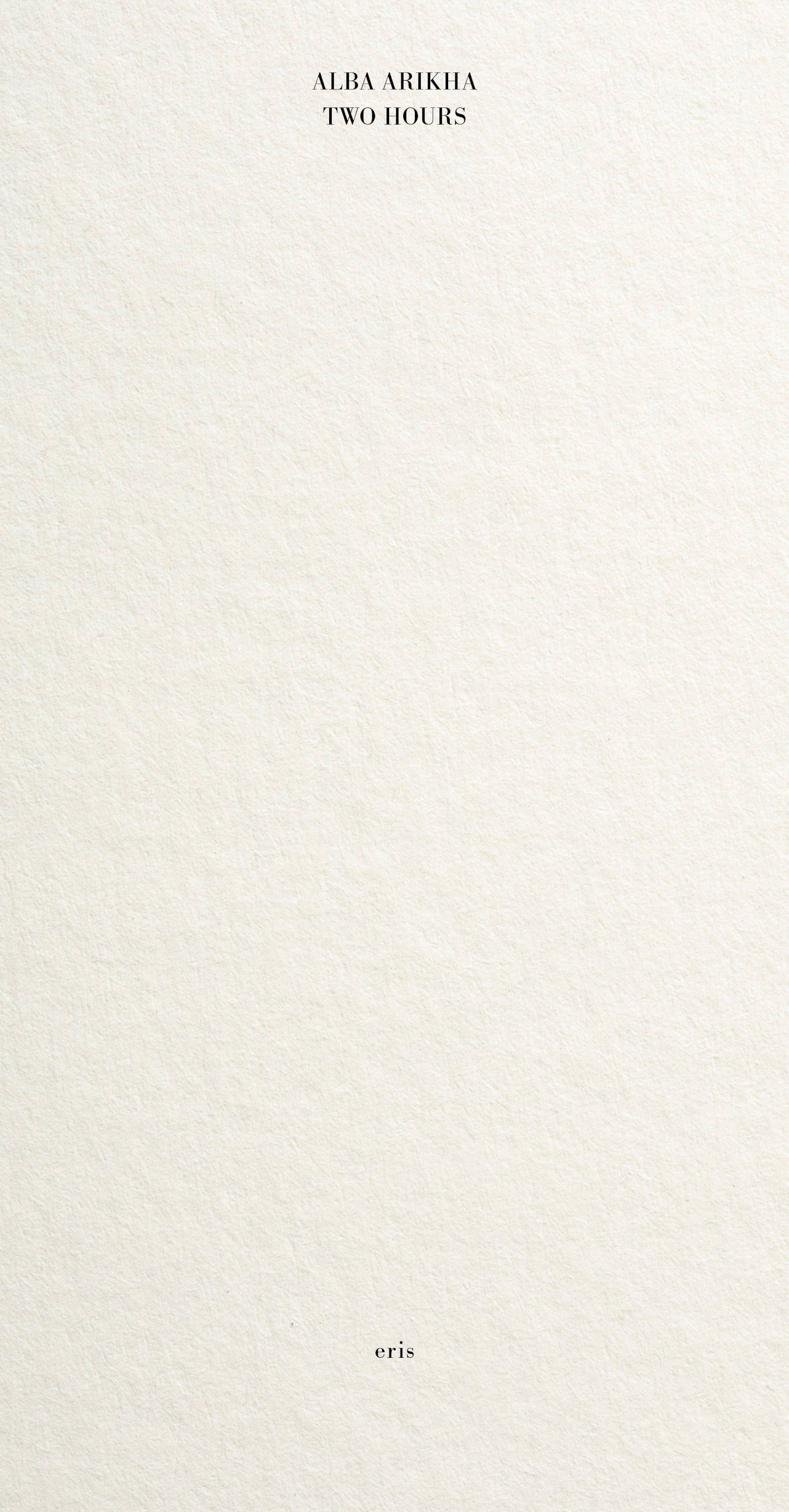
Clara hat die Fähigkeit, sich selbst aus der Distanz zu betrachten, wie ein Fotograf, der ein Teleobjektiv einsetzt. „Ich kann mich selbst sehen, wie ich aus diesem Wohnhaus heraustrete“, sagt sie in einem kurzen Moment der Anerkennung ihrer Technik, und diese Fähigkeit, sich gleichzeitig zu beobachten und zu offenbaren, zieht sich durch den gesamten Roman.
Es gibt auch unverkennbare Anspielungen auf den Stil von Rachel Cusk, die diese Art der hochästhetisierten Selbstbetrachtung perfektioniert hat (eine Begegnung, die in einem Flugzeug stattfindet, könnte direkt aus Cusks Roman stammen). Ein großes Lob). Doch in vielerlei Hinsicht ist Arikha überhaupt nicht wie Cusk – sie ist auf dem Papier umgänglicher und offensichtlich kunstvoller. Und viel unterhaltsamer. „Ich schreibe Romane, die mein Leben widerspiegeln“, sagt Clara. „Mutterschaft, Ehestreitigkeiten, Immobiliensehnsucht.“
Sie ist auch Jüdin. Mehrere Mitglieder der Familie von Claras Mutter sind im Holocaust umgekommen, und obwohl dies den etwas unbeholfenen Eindruck einer unverdauten persönlichen Geschichte vermittelt – eine Vertreibung in der dritten Generation, mit der sich die Figur Clara noch nicht vollständig auseinandergesetzt hat –, passt es in einen Roman, der scharfsinnig auf Ideen der Vertreibung und die Auswirkungen der Vergangenheit reagiert. Alexanders eigene Mutter wurde 1945 in Auschwitz geboren und begeht zu Beginn des Romans Selbstmord. „Sie konnte mit ihrer Vergangenheit nicht leben“, sagt Claras Vater. Im Hintergrund des Romans gibt es ein wiederkehrendes Thema von Kindern, die im Umfeld schwer geschädigter Mütter aufwachsen, und das Erbe dessen, was nicht angesprochen wird. Auf einer geringeren Ebene wird Clara manchmal auch schuldig sein, Dinge nicht anzusprechen.

Das alles liest sich extrem mühelos, doch ist eine so klare und präzise Prosa alles andere als einfach zu schreiben. Arikha kontrolliert die Informationen, die sie preisgibt, extrem – selbst scheinbar nebensächliche Details können unerwartet wichtige Informationen liefern. In der Schule wird Clara für ihre Tagträumerei auf die Finger geklopft. Sie zuckt zusammen, weint aber nicht. „Ich weine selten in der Öffentlichkeit“, erzählt sie uns. Diese trügerisch beiläufige Selektivität wird im Verlauf des Romans immer häufiger, bis zu dem Punkt, an dem der Leser sich durch die abrupte Informationsübermittlung auf dem falschen Fuß erwischt fühlt. Ohne große Vorbereitung werden wir in den Treibsand von Claras zunehmend bitterer Ehe, ihrer extremen postnatalen Depression und ihrem wachsenden Erfolg als Romanautorin gestoßen. Manchmal wird unsere Sicht auf Clara auch in einer Sekunde durch eine beiläufige Bemerkung einer anderen Person verändert. „Bei dir war es schon immer so“, sagt Claras Schwester, frustriert über ihre Zurückhaltung, über ihre Ehe zu sprechen. „Wir bekommen die Reste, ohne zu wissen, woher sie kommen.“
Zwei Stunden endet auf unerwartete Weise, aber vielleicht musste es das schon immer sein. „Ihr Weg verlief nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte“, sagt Clara über ein Gespräch mit einer Freundin und fügt dann hinzu: „Ich antwortete, dass das oft nicht der Fall war.“ Es ist ein Zeichen der sanften Weisheit dieses Romans, dass er die Schönheit darin findet, den Weg zu akzeptieren, den ein Leben nehmen kann, anstatt mit Bedauern zurückzublicken.
